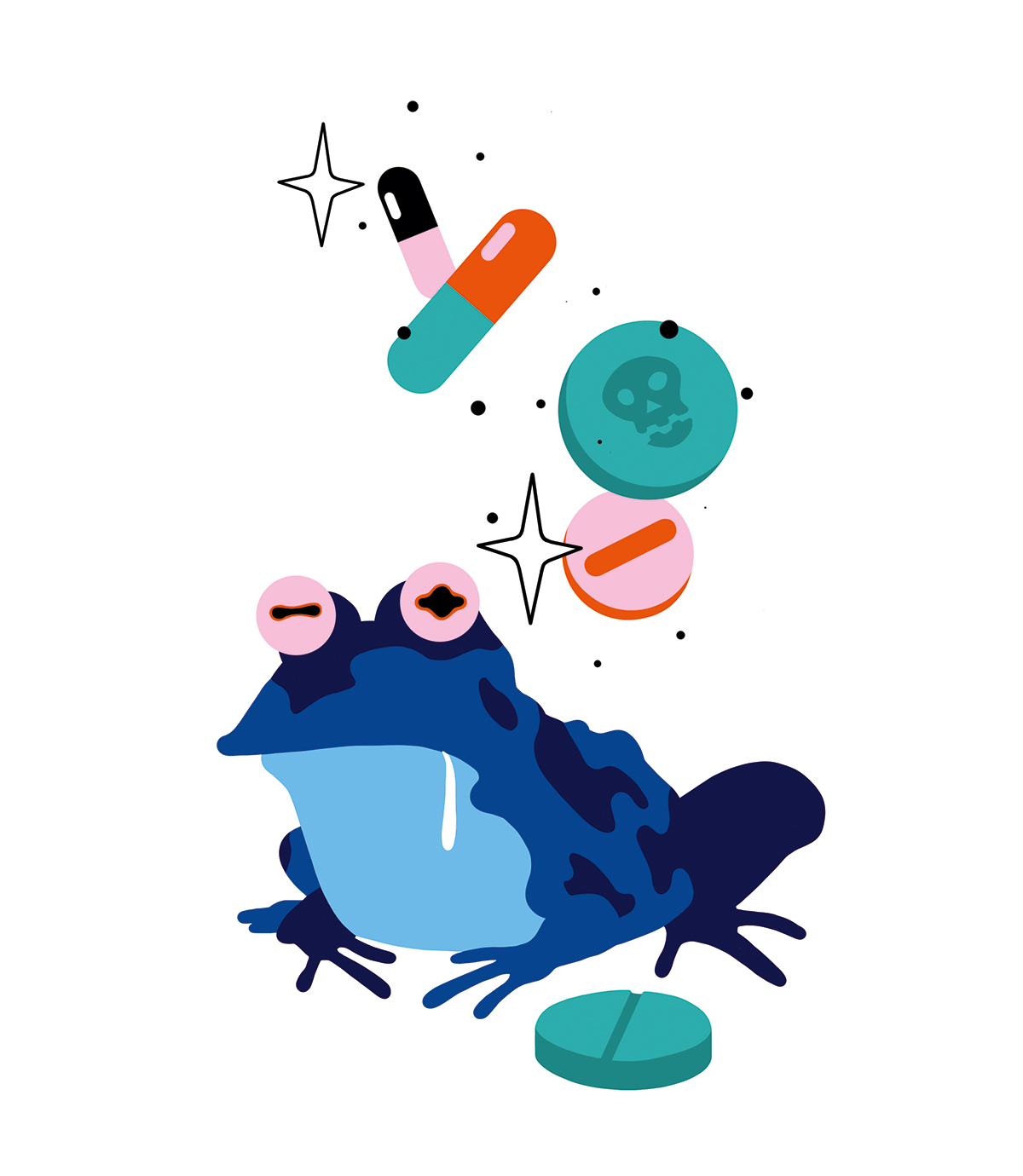Zwischen Verbundenheit und Abscheu: Im doku.klasse-Workshop spricht Robin Humboldt über den problematischen Umgang mit seinem Protagonisten und dessen Tat und überlegt sogar, das Projekt abzubrechen.
Robin Humboldt kennt sich durch seine vorherigen Filme mit stigmatisierten Milieus aus. Doch Alexanders Absturz im Laufe der Recherchen und Dreharbeiten stellt ihn vor bislang ungekannte Herausforderungen. »Ich frage mich, ob es gesund ist, mit dem Film weiterzumachen«, merkt eine Teilnehmerin der doku.klasse an.
Schon ziemlich bald hatte Humboldt bemerkt, dass es seinem Protagonisten immer schlechter ging. »Er wirkte von Mal zu Mal apathischer und unerreichbarer.« Als er davon erfuhr, was Alexander getan hat, sei er schockiert und zutiefst enttäuscht gewesen. Alle Pläne und Konzepte, die es für den Film bis dahin gab, waren obsolet. Das Projekt liegt auf Eis. Wie geht es nun weiter?
Trotz aller Zweifel und Bedenken und der starken emotionalen Belastung, die das Thema und der Totschlag für den Regisseur bedeutet, möchte er auf jeden Fall weitermachen. »Ich will der Geschichte von Alexander gerecht werden, ohne ihn aber vom Täter zum Opfer zu machen.« Es ginge ihm darum, alle Facetten der Situation aufzuzeigen. Dafür könne er sich vorstellen, von der klassischen Form des Dokumentarfilmes abzuweichen.
Aus den Reihen der Teilnehmer*innen kommt die Frage auf, ob sich der Regisseur auch vorstellen könne, auf die Beziehung einzugehen, die er mit Alexander aufgebaut hat. Ja, so Humboldt, zum Beispiel hält er es für möglich, einen Briefwechsel zwischen ihm und Alexander zu zeigen. Abseits der experimentellen Annäherungsweisen wolle er versuchen, im Gefängnis zu drehen. Seit dessen Verhaftung habe er Alexander schon des Öfteren dort besucht. »Momentan befindet er sich in einer psychiatrischen Abteilung der JVA. Ich hoffe, dass die Abwärtsspirale sich nicht wieder zu drehen beginnt, wenn er in den Regelvollzug versetzt wird.«